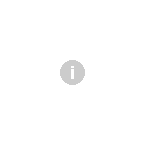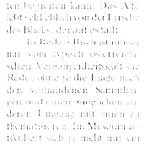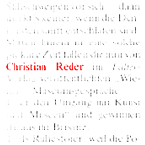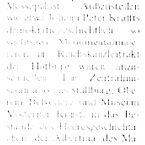| |
|
|
Transferprojekt Damaskus
urban orient-ation
|
|
|
Herausgegeben von Christian Reder und Simonetta Ferfoglia
Institut für Medienkunst / Kunst- und Wissenstransfer
Universität für angewandte Kunst Wien
Edition Transfer bei Springer Wien New York 2003
402 Seiten, durchgehend in deutscher und arabischer
Sprache
|
|
"Transferprojekt Damaskus" ist ein Kompendium
zu audiovisueller Erforschung von Urbanität,
zu künstlerisch-essayistischen Sichtweisen,
zu transkultureller Arbeit über symbolische Dimensionen
und Facetten sozialen Handelns, als experimenteller
Umgang mit Komplexität.
|
|
|
|
Am mythischen Ausgangspunkt von Migration und Urbanität
Nomaden, Wanderer, Vermittler als Prototypen des angeblich
"flexiblen Menschen"
|
|
| Das
exemplarisch Urbane an einer der "ältesten Hauptstädte
der Welt", so die in Syrien selbstverständliche Version,
verführt dazu, sich in Reflexionen darüber zu verlieren,
welche Austauschbeziehungen und Konfliktregelungen derart vitale,
Zeiten und Räume verbindende Traditionen bestärkt
haben. Vor solcher Uferlosigkeit retten Anhaltspunkte; einer
davon, unscheinbar an der kargen Peripherie liegend, hat erst
nach und nach sein Potenzial offenbart: als Einstieg in ein
Labyrinth, als Einstieg in Symbolwelten, die über biblisch
klingende Ausdrucksweisen fortwährend aktualisiert werden.
Denn vom Kampf des Guten gegen das Böse, von Vergeltung,
von Sesshaften und Nomaden ist erneut ziemlich oft die Rede.
Kabil und Habil
Die Stelle, von der es heißt, an ihr habe der erste
Mord, das erste Sterben überhaupt stattgefunden, als
Auslöser gesellschaftlicher Dynamik, liegt hoch über
Damaskus, am steilen Hang des Jebel Al-Qassyun; sie ist ein
"point of view" in realem und virtuellem Sinn. Von
den letzten dicht verschachtelten Häusern des Stadtrands
führt ein felsiger Pfad hinauf. Der nur zu Fuß
erreichbare Schauplatz wird Magharat ad-Dam, die "Höhle
des Blutes" genannt und als vor Entsetzen über die
Tat Kains (arab. Kabil/Qabil) und den Tod Abels (arab. Habil)
aufgerissenes Maul des Berges gedeutet. Er
ist Teil einer alten, von hohen Mauern umschlossenen Gedenkstätte
mit baumbestandenem Innenhof, kleiner Moschee und Beherbergungsräumen;
schon in der Antike soll es dort eine Tempelanlage gegeben
haben. Eine Bedeutung, in universellem Sinn, hat der Ort nicht
erlangt; auch nicht das gut einen Tagesmarsch von ihm entfernte
Grab Abels im Barada-Tal. Abel wurde vom Täter selbst
- im ersten überlieferten Akt dieser Art - nach dem Vorbild
eines Raben, "der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen,
wie er die Leiche seines Bruders verbergen könne",
bestattet (Koran 5,31). (1)
|
|
|
Gerade solche Differenzen zwischen Behauptung
und Akzeptanz haben mich angezogen; das keiner Religion allein
Zuordenbare, das Angebliche. Für ein zivilisationsgeschichtlich
so zentrales mythisches Geschehen verwundert die zurückhaltende,
gelassene Art des Erinnerns. Es genügt die Möglichkeit,
dass all das, weil es so überliefert ist, dort stattgefunden
haben könnte. Beim in der Mitte des Paradieses stehenden
"Baum der Erkenntnis von Gut und Böse" (Gen.
2,17), (2)
inzwischen der Rand des ärmlichen Ortes Al-Qurna am Zusammenfluss
von Euphrat und Tigris, ist das auch so. Als
ich vor Jahren dort vorbeikam, wurde einem der so bezeichnete
Baum gezeigt, eingezäunt und von einem Soldaten bewacht.
Ob er die Kriege seither überstanden hat, ist mir nicht
bekannt. Mitgebrachtes Laub liegt irgendwo in einer Mappe.
Dieser Versuch, den Garten Eden zu lokalisieren, wird unter
anderen auf den englischen Bauingenieur William Willcocks
zurückgeführt, der glaubte, die biblischen Berichte
mit den Flussläufen der Region in Einklang bringen zu
können. (3)
Kain und Abel werden schon viel länger mit der Höhle
oberhalb von Damaskus in Verbindung gebracht. Dass
es seit je, zumindest aber seit Jahrhunderten, Pilger an diesen
Ort zieht, haben Reisende wie Ibn Gubair, der die Stadt im
Jahr 1184 westlicher Zeitrechnung besuchte, oder Ibn Battuta,
der 1326 dort war, fast gleich lautend unter Berufung auf
alte Chroniken beschrieben: "Sie bestätigen, dass
Ibrahim [Abraham], Musa [Moses], Isa [Jesus], Lut [Lot] und
Aiyub [Hiob] - Gott schütze sie alle - in dieser Höhle
gebetet haben." (4)
Der Geburtsort Abrahams, der zusammen mit seinem Sohn Ismael
die Kaaba in Mekka errichtet hat (Koran 2,127), wird unweit
davon angesiedelt, als Möglichkeit; denn dass er, der
"Vater der Völker", aus der Gegend von Ur im
heutigen Irak stammt, war stets genauso geläufig. Als
Ort des Jüngsten Gerichts sind der Jebel Al-Qassyun und
das Jesus-Minarett der Omaiyadenmoschee, in Konkurrenz zu
Jerusalems Ölberg mit dem Joschafat-Tal nebenan, fester
Bestandteil islamischen Volksglaubens.
Solche von gewohnten Zuordnungen abweichende Symbolismen
finden in sachlichen Darstellungen für gewöhnlich
höchstens eine marginale, ironische Erwähnung, vermutlich
wegen fragwürdiger Authentizität. Allen beteiligten
Parteien ging es verständlicherweise darum, zu Gläubigkeit
gehörendes Geschehen anhand bestimmter Orte realer zu
machen, wie fiktiv das auch sein mochte. Vorstellungsräume
aber dürften sich in dem Maße ausweiten, wie es
gelingt, ohne gleich zu urteilen, zwischen Eigenem und Fremdem,
also Bekanntem und weniger Bekanntem, Relationen herzustellen.
Das Gerede über Unterschiede untergräbt die Bereitschaft,
Ähnlichkeiten wahrzunehmen; jetzt und bezogen auf Geschichte.
"Mythologie ist ihrer Natur nach Religion, Kunst und
Philosophie", konstatiert in diesem Sinn auch Sadik J.
Al-Azm, seit seiner "Kritik des religiösen Denkens"
(Naqd al-fikr ad-dini) umstrittenster syrischer Philosoph,
denn mythisches Denken bloß als Aberglaube abzutun,
negiere es als "kreative, zivilisatorische Kraft".
Damit bei der Beschäftigung mit solchen
Themen "die schier unglaubliche Dynamik und Kraft, der
unwiderstehliche Druck und Zauber der Moderne", wie er
es nennt, mitgedacht werden könnten, bedürfe es
hin und wieder "Strategien der Verdrehung, der Verschmelzung
und des Vermischens des Profanen mit dem Heiligen, des Lächerlichen
mit dem Erhabenen und des Frommen mit dem Grotesken".
(5)
Konventionelles Umgehen damit könne
vorgeprägte Muster kaum in Frage stellen. Das ist auch
mit essenziellen mythischen Grundlagen "westlicher"
Einstellungen so; sie beziehen sich, vielfach uneingestanden,
auf Ägypten, Palästina und Syrien, auf Anatolien
und Mesopotamien - mit den ersten großen frühchristlichen
Gesellschaften, den ersten bedeutenden christlichen Städten:
Antiochia, Damaskus, Alexandria; dem ältesten Kirchen-,
Eremiten-, Mönchs-, Nonnen- und Klosterwesen."Kulturelles"
jedoch spielt in Konflikten höchstens eine vordergründige
Rolle; auch Kriege um biblische Stätten werden mit biblischen
Begriffen gerechtfertigt. In islamisch geprägten
Zusammenhängen ist offensichtlich, "wie stark die
Sprache des Koran die literarische wie die Alltagssprache
durchdrungen hat", selbst wenn viele davon Beeinflusste
sie gar nicht verstehen. (6)
Das ästhetische Erlebnis steht, anders als bei der Bibel,
gleichrangig neben den inhaltlichen Komponenten. (7)
Für Radikalisierungen lassen sich alle solche Texte missbrauchen.
An westlichen Begriffswelten fällt auf, wie stark die
Gründungsmythen des Alten Testaments über die Anfänge
der Menschheit, mit ihrer Gegenüberstellung von Hirten
und Bauern, von Nomaden und Sesshaften, von Stadt und Land
weiterhin die Metaphern prägen, fast stärker als
der Sündenfall von Adam (arab. Adam) und Eva (arab. Hawwa),
bei dem es bekanntlich um Erkenntnis ging. Das Leben als Reise,
als dorniger Weg, als geistige Reise, sind solche Bilder;
bezogen auf diverse Formen von Exil, auf Entwurzelte, Heimatlose,
Flüchtlinge, Vertriebene, Migranten blieben sie tendenziell
negativ besetzt, als vermeintliches Schicksal. Was von außen
auf Metropolen zukommt, hat immer schon deren Inneres strukturiert,
als Orte der Vermischung. Ohne darauf einzugehen, lässt
sich über Stadt und Urbanität heute nicht denken.
Die Reaktionen auf das tatsächliche Geschehen aber scheinen
sich eher an den hoffnungslosen Wanderungsgeschichten der
alten Texte zu orientieren.
Abel, der Hirte, sollte von Berufs wegen, Kain aus Strafe
umherziehen müssen: "Rastlos und ruhelos wirst du
auf der Erde sein" (Gen. 4,12). Er wurde nun "einer
von den Verlorenen"; wörtlich: "einer von denen,
die den Schaden haben" (Koran 5,30). Auslöser für
dieses angeordnete, auch in diversen übertragenen Formen
stattfindende Nomadisieren ist der Legende nach das Geschehen
am Qassyun-Berg. In sonderbar beharrlichem Gegensatz dazu
wurde der "verfluchte" Ackerboden (Gen. 3,17) zum
Inbegriff für heimatliche Bindungen. Fort zu wollen oder
fort zu müssen, wird als Ausnahme gehandelt, trotz der
Normalität und auch "Modernität" solcher
Situationen. Fortkommen mutierte zum Karrierebegriff;
als Freiheitsdrang wird es diskriminiert oder verklärt.
Für den christlichen Vordenker Augustinus, selbst ein
Nordafrikaner, waren von vornherein Jenseitsbezüge wichtiger,
denn dieser erste Tod, der eines Nomaden, habe deutlich gemacht,
"dass Sterben kein Übel war, denn der Gerechte starb
als Erster". Abel wird wegen seiner Friedfertigkeit zum
Märtyrer, zum Zeugen; Kain aus Neid, wie es anderswo
heißt, "exemplarischer Repräsentant der Machtgier".
(8) Der große,
aus Rumänien stammende Religionswissenschaftler Mircea
Eliade wiederum stellt unverblümt Bezüge zu Urbanität
und zu gegenwärtigen, von technischen Entwicklungen geprägten
Gesellschaften her: "Der Name Abel nämlich bedeutet
‚Hirt', der Name Kain dagegen bedeutet ‚Schmied'."
Abgeleitet von der ambivalenten Situation des Schmiedes bei
bestimmten Hirtenvölkern, der "verachtet oder respektiert,
stets aber gefürchtet wird", spiegle "die im
biblischen Bericht bewahrte Tradition die Idealisierung des
‚schlichten und reinen' Lebens der Nomadenhirten und
den Widerstand gegen das sesshafte Leben der Ackerbauern und
Stadtbewohner" wider. "Kain wurde
zum ‚Erbauer der Stadt' (Gen. 4,17), und einer seiner
Nachkommen ist Tubal-Kain, ‚der Stammvater aller Erz-
und Eisenschmiede' (Gen. 4,22). Der erste Mord geschieht also
durch den Menschen, der in gewisser Weise das Symbol der Technologie
und der Stadtkultur inkarniert. Alle Techniken sind - wenigstens
implizit - der ‚Magie' verdächtig." (9)
Satan (Iblis) weiß, warum er dabei dem Menschen überlegen
ist: "Mich hast du aus Feuer erschaffen, ihn (nur) aus
Lehm" (Koran 7,12).
Umfassende Erklärungsmuster dieser Art kommen einem
am angeblichen Ort des Geschehens nicht in den Sinn; er ist
eher ein Ausgangspunkt. Auf die Symbolkraft der Tat ist mit
einem stillen, meditativen Bau geantwortet worden, so wie
bei anderen heiligen Stätten der Umgebung, etwa dem Grabmal
von Mohammeds Tochter Fatima am Bab-as-Saghir-Friedhof im
Süden der Altstadt oder jenem für Saladin (Salah
al-Din) neben der Omaiyadenmoschee. Deren Schrein für
den Kopf von Johannes dem Täufer steht ebenfalls eher
beiläufig irgendwo in der großen Halle. Zur Höhle
kommt nur, wer den Aufstieg auf sich nimmt. Um den Weg zu
finden, brauchen Fremde die Hilfe Ortskundiger. Seit vierhundert
Jahren ist die gleiche Familie für das Gebäude zuständig.
Deren Erzähltradition macht einem die islamische Version
des Konflikts zwischen den Brüdern bewusst: Es ging um
zwei Frauen. Denn Abel hätte die schöne Zwillingsschwester
von Kain und dieser die ihm weniger attraktiv erscheinende
Zwillingsschwester Abels heiraten sollen. Das wollte Kain
nicht, ein Opfer sollte entscheiden, angenommen wurde nur
das von Abel. Mysteriös ist auch, dass Kain vom Erzengel
Gabriel vor dem zuschnappenden Maul des Berges gerettet wurde;
dessen abstützender Handabdruck wird einem gezeigt und
auch ein schwerer Stein, als Symbol für die Tat, sowie
aus dem Fels rinnende Wassertropfen, als Tränen des Berges.
Rotes Gestein und roter Sand versinnbildlichen das Blut. Vielleicht
war vom himmlischen Gericht bloß auf Totschlag im Affekt,
der Milde verdient, entschieden worden. Die bessere Nachrede
hat eindeutig der erste "gute Hirte", unbekümmert
nomadische Lebensformen werden dennoch nur für Privilegierte
akzeptiert. Das ist auch arabischen Traditionen nicht fremd,
als Konflikt zwischen Umherziehenden und den Oasenbewohnern:
"Die Beduinen sind mehr (als die sesshaften Araber) dem
Unglauben und der Heuchelei ergeben" (Koran 9,97).
Den Erbauern der Gedenkstätte am Berg Qassyun scheint
diese fortwirkende Ambivalenz bewusst gewesen sein, denn in
der "Höhle des Blutes" gibt es nur zwei Gebetsnischen
(Mihrabs). Die eine ist Abraham gewidmet, dem von allen in
dieser Region entstandenen Religionen geschätzten Stammvater
aus der Wüste ("Ich will dich zum Vorbild für
die Menschen machen", heißt es in Sure 2,124 über
ihn und die Sure 3,67 präzisiert: "Abraham war weder
Jude noch Christ"), die andere einem außerhalb
islamischer Gelehrsamkeit im Westen kaum bekannten Heiligen
namens Al-Khidr. Ihm nachzuspüren, war nahe liegend,
um im Allgemeinen Spezielleres zu fassen zu bekommen, im Sinn
einer Kartografie von Namen, die Teil kulturübergreifender
Transfers geworden sind.
|
 |
Am Berg des jüngsten Gerichts:
Kain erschlägt Abel
|
|
| Exkurs
über Al-Khidr und Georg, Beschützer der Wanderer und
Reisenden
Uneingeweihten gegenüber repräsentiert Al-Khidr
den Fremden. Dessen exponierte Positionierung an einem wichtigen
mythischen Ort macht auf eigenes Unwissen aufmerksam, aber
auch darauf, wie unzugänglich beidseitig schriftliche
Quellen weiterhin sind. Im Zuge meiner Nachforschungen über
aus dem syrischen Raum stammende Vermittler, die als Figuren
und Namensgeber im Osten und Westen eine Rolle spielen, hatten
mich solche Zusammenhänge und zugehörige Geschichten
zu interessieren begonnen. In der neuen,
Faktoren für Identitätsbildung untersuchenden Studie
des Wiener Ethnologen Gebhard Fartacek über "Pilgerstätten
in der syrischen Peripherie", die auch besagte Höhle
einbezieht, findet sich eine verblüffende Antwort: Al-Khidr
(auch: al-Hidr, al-Hadr, al-Hadir) "ist der Name eines
berühmten Heiligen, der von den Christen mit dem heiligen
Georg [arab. Mar Girgis] gleichgesetzt wird. Unter sunnitischen
Moslems verkörpert er eine mythologische Gestalt, deren
Wurzeln in die vorislamische Zeit zurückreichen."
(10) In Albert
Houranis "Die Geschichte der arabischen Völker"
wird das bestätigt: "Quellen, Bäume und Felsen,
an denen man schon vor dem Aufkommen des Islam oder sogar
des Christentums Fürbitte und Heilung erfleht hatte,
waren manchmal den Anhängern verschiedener Religionen
heilig. Beispiele dafür hat man in modernen Zeiten gefunden:
in Syrien wurde Khidr, der geheimnisvolle Geist, in dem man
den heiligen Georg sah, in Quellen und an anderen heiligen
Plätzen verehrt." (11)
|
|
|
In Koran-Kommentaren wird Abul Abbas Al-Khidr als durch die
Zeiten wandernder Weiser und Lehrer des - der Legende nach
ebenfalls in Damaskus begrabenen - Moses genannt; ihr Zusammentreffen
wird als vielsagendes Gleichnis betrachtet (Koran 18,60-82).
Behauptete motivgeschichtliche Zusammenhänge
mit dem Alexanderroman werden von dieser Seite her verständlicherweise
bestritten, die Frage: "Wer ist Khidr?", bleibt
für viele Interpretationen offen. Manche zählen
ihn zu jenen vier Propheten, "die lebendig in den Himmel
aufgenommen worden sind - Idris [Andreas], Khidr, Ilyas [Elia]
und Isa [Jesus]"; er gilt als "der Schutzheilige
der Reisenden, der Unsterbliche, der aus der Quelle des Lebens
getrunken hat". Der große Philosoph
islamischer Mystik Ibn Arabi, dessen Grab im Stadtteil Salihiye
unterhalb der Höhle liegt, hat sich ausdrücklich
auf Kontakte mit ihm berufen. (12)
Auch eine Identität von Elia und Khidr wird behauptet,
"beide gelten als unsterbliche Wesen und als Schutzgeister
aller Verzweifelten". (13)
Khidr bedeutet wörtlich übersetzt "der Grüne".
"In welche Gegend der Heilige auch immer kommt, sie wird
grün und fruchtbar", heißt es in erläuternden
Erzählungen. Das Grün als Farbe
des Islam spielt mit herein. Bekannt ist er auch als "der
Verborgene", als zeitloser Prototyp späterer "verborgener"
Vermittler höherer Einsichten. Beim Tod Mohammeds soll
seine Stimme die Angehörigen getröstet haben. Speziell
in Sufitraditionen spielt er als plötzlich erscheinender
Begleiter, Lehrer und Helfer weiterhin eine wichtige Rolle.
Für die Naqshbandi-Sufis ist er der zehnte Heilige in
einer "goldenen" Reihe von vierzig, deren bislang
letzter, Scheich Nazim al-Haqqani, in Damaskus lebt. (14)
Dass selbst große Propheten solchen im Hintergrund wirkenden
Wesen Einsichten verdanken, wird unter Hinweis auf die Sure
12,76 bekräftigt: "Und über jedem, der Wissen
hat, ist einer, der (noch mehr) weiß." Als Parabel
über Vermittlung gelesen, bilden die Legenden um Al-Khidr
und Georg gleichsam zwei Zugangsweisen ab: anonyme, ausgleichende
Hintergrundarbeit und die strahlend inszenierte Militanz des
in Syrien und im Libanon präsentesten christlichen Heiligen,
des auch im Westen praktisch jedem Kind bekannten Drachentöters.
Wie das vereinbar sein sollte, bleibt merkwürdig.
Auf eine in den Vorstellungen verankerte Identität der
beiden verweisen ihnen zugeschriebene Gräber, jenes in
der griechisch-orthodoxen Georgskirche (arab. Kanise al-Khidr)
in Ezra im Süden Syriens, das in der Zitadelle von Aleppo,
wo Al-Khidr mit dem "Torwächter Georg" gleichgesetzt
wird, und ein Al-Khidr- und Georgsgrab unweit des Krak des
Chevaliers, in dessen Nähe sich auch ein Georgskloster
befindet. In Bosra steht eine Al-Khidr-Moschee. Ein im Wiener
Museum für Völkerkunde verwahrtes altes Foto des
Georgsgrabes in Damaskus hat sich als nicht verifizierbar
herausgestellt; auf dem am ehesten in Frage kommenden Ash-Sheikh-Rislan-Friedhof
wird es für unmöglich gehalten, dass es dort jemals
ein christliches Heiligengrab gegeben habe. Die
griechisch-orthodoxe Georgsgedenkstätte am St. Georgsfriedhof
vor dem Stadttor Bab Kissan in Damaskus jedoch wird in hohen
Ehren gehalten. Ob solche Gräber authentisch sind, spielt,
so heißt es in Gesprächen generell, für die
Wertschätzung Gläubiger keine Rolle, geht es doch
vor allem um geistige Segenskraft, um Baraka, und um den zugleich
sterblichen und unsterblichen mythischen Besitzer solcher
sakralen Plätze. Deren Bedeutung umzuformen, ist stets
ein plausibler Vorgang gewesen. (15)
Sich überschneidende Zuordnungen schlagen Brücken
zwischen Gläubigkeitssphären. Das wird von offizieller
Seite in aller Regel negiert; in keiner westlichen Georgsbeschreibung
habe ich einen Hinweis auf Al-Khidr gefunden. In ihnen heißt
es in der Regel, die Georgskirche in Lod (dem antiken Lydda
in Palästina) sei über Georgs originalem Grab errichtet
worden. Manchen der lokalen Gesprächspartner ist vage
etwas von Parallelexistenzen bekannt, für Ghattas Hazim
wiederum, den griechisch-orthodoxen Bischof von Damaskus,
geht es eindeutig um zwei verschiedene Heilige.
In das Durcheinander legendärer Vorbilder Ordnung zu
bringen, würde auch zu nichts führen; die zahllosen
einander überlagernden Geschichten haben ohnedies ihre
eigene literarische Dimension, gerade auch im Stereotypen:
Christlichen Heiligenlegenden wird vorgeworfen, durch "ein
rundum harmonisches Bild" jegliche individuellen Züge
zu negieren, bei islamischen konzentriert sich die Kritik
auf "die völlige Überholtheit der unablässig
frömmlerisch wiederholten Erzählungen".
(16) Trotzdem
bleiben Vorgänge dieser Art kulturprägend, auch
in modern-medialem Sinn, als Konsequenz sakral-profaner Vermittlungsvorgänge
und analoger Arten, Vorbildhaftes zu propagieren.
"Wer den Kult verstehen will, der sich um Che Guevara
gebildet hat", schreibt Hans Magnus Enzensberger dazu,
"kommt um die Geschichte der Heiligen nicht herum, und
wer wissen will, wie böse das Monopolkapital wirklich
ist, sollte sich einer eingehenden Beschäftigung mit
dem Teufel nicht verschließen." (17)
Dem Satan hat übrigens auch Sadik J. Al-Azm einen eigenen
Essay gewidmet. (18)
Auf die Symbolik der "Höhle des Blutes" oberhalb
von Damaskus bezogen, fällt auf, dass von den vier mit
diesem Ort verbundenen Namen, Kain und Abel, Abraham und Al-Khidr,
vor allem die vage Verbindung zu Georg weithin Wirkung gezeigt
hat. Abraham findet sich in Abraham Lincoln wieder. Das Bild
vom Sieger über das Böse und Helden der Kreuzfahrer
hatte viel stärkere Resonanz. Namensgeber ist er für
George Washington oder George Bush - aber auch für George
Orwell, Georges Braque, Georges Bataille, Georg Büchner,
Georg Trakl, Georg Lukács, Giorgio de Chirico, Giorgio
Strehler, Giorgio Armani, Giorgios Seferis, György Ligeti,
Jorge Luis Borges, für diverse Könige oder, über
George Everest, indirekt auch für den höchsten Berg
der Welt. In der Alltäglichkeit tausendfacher Verwendung
dürfte längst jeder Bezug zum Vorbild und zu dessen
historischer Einordnung verloren gegangen sein. Auch der Kampf
mit dem Drachen hätte immer schon irgendwo stattfinden
können, als Konfrontation mit dem Negativen schlechthin.
Nur: Wäre bewusster geblieben, dass Georg aus heutiger
Sicht nicht als Europäer gelten würde und er vermutlich
einen islamischen Doppelgänger hat, hätte die Verbreitung
seines Namens deutlicher als Zeichen für Mehrfachidentitäten
verstanden werden können.
|
 |
Elia und Khidr an der Quelle des
Lebens (Ausschnitt). Persische Miniaturmalerei, spätes
15. Jahrhundert. Freer Gallery of Art, Washington,
D. C. In: Shaykh Muhammad Hisham Kabbani: The Naqshbandi
Sufi Way. History and Guidebook of the Saints of the
Golden Chain. Chicago 1995, S. 118
|
 |
In Damaskus verbreitetes Heiligenbild
von St. Georg
|
|
| Von
Al-Khidrs Existenz ist nur bekannt, dass er gelegentlich irgendwo
auftaucht. Für den ebenfalls von Zeit zu Zeit erscheinenden
christlichen Georg hingegen kursieren ausgefeilte - dennoch
widersprüchliche - Lebensbeschreibungen. Bereits die frühen
syrischen Texte über ihn stilisieren eine reale Figur zum
Helden. Zur Lichtgestalt, die in entscheidenden Momenten auftritt,
wurde er erst während der Kreuzzüge. Er soll aus der
heutigen Türkei stammen, im römischen Militärdienst
gestanden und um das Jahr 300 in Palästina nach schweren
Folterungen als Märtyrer gestorben sein. Zum legendären
Kampf mit dem Drachen, der nahe der Stadt Silena in der Provinz
Lybia (vielleicht aber auch in Kappadokien) stattgefunden haben
soll, ist er vom Himmel herabgestiegen. Georgs Sieg über
ihn steht für ein neues Bewusstsein; die gerettete Königstochter
gilt als Verkörperung der Kirche. Mit Demetrius und Theodor
zählt Georg zu den meistverehrten Heiligen der Ostkirche;
die beiden Letzteren empfangen einen am Portal der Kathedrale
von Chartres. Die Legenda aurea aus dem 13. Jahrhundert berichtet,
"wie Georg in weißer Rüstung den Kreuzrittern
vor Jerusalem erschien: von Gott zur Erde zurückgeschickt,
habe er sie unterstützt, die Sarazenen zu erschlagen und
Jerusalem zu erobern." Mit diesem Hintergrund
wurde er zum Symbol der Ritterlichkeit, zum Patron von Richard
Löwenherz und von England. Georgien und der US-Bundesstaat
Georgia sind nach ihm benannt. Für Soldaten, Bauern, Reiter,
Bergleute, Sattler, Schmiede, Böttcher, Pfadfinder, Artisten,
Wanderer, Gefangene, Spitäler und Siechenhäuser, Pferde
und das Vieh gilt er als Schutzherr. Sein
Kopf wurde angeblich als Reliquie ins Herz Europas, auf die
Insel Reichenau im Bodensee gebracht, ein Arm in den Dom von
Prag, der andere nach Köln. (19)
Edward Gibbon, "der Skeptiker, Wissenschaftler und Anti-Christ"
(Barbara Tuchman) (20),
hat in seinem groß angelegten Geschichtswerk über
das Römische Reich den heiligen Georg ganz anders gezeichnet,
nachdem er, mit "kühlem, unvoreingenommenem, ungläubigem"
Blick, wie er betont, die ursprünglichen Berichte analysiert
hatte. Von Vorbildlichkeit bleibt da nichts übrig. Denn
Georg habe es, aus ärmlichen Verhältnissen kommend,
geschafft, durch Betrug und Korruption zum reichen Specklieferanten
der römischen Armee zu werden, angetrieben von seinem
"Talent zum Parasiten". Nach der
Flucht vor gerichtlicher Verfolgung durch ganz Syrien eröffneten
sich ihm am "von Grausamkeit und Habgier vergifteten"
Hof des Athanasius, Bischof von Alexandria, neue Möglichkeiten.
Während gegen dessen Herrschaft gerichteter Tumulte sind
Georg und andere Günstlinge der Lynchjustiz aufgebrachter
Massen zum Opfer gefallen. Ihre leblosen
Körper wurden "auf dem Rücken von Kamelen im
Triumph durch die Straßen geführt" und zuletzt
ins Meer geworfen. Alle religiösen Interpretationen seien
späteren Datums. (21)
Dass das Klima im Umfeld des Athanasius, immerhin Biograph
des durch ihn zur Legende gewordenen ägyptischen Wüstenheiligen
Antonius, "auf Unterschlagung und Gewaltanwendung beruhte",
bekräftigt auch ein Spezialist für diese Zeit wie
Peter Brown. (22)
Vielleicht ist Georg gerade wegen seiner Flexibilität
im Umgang mit solchen zeitlos erscheinenden Bedingungen zum
Beschützer der Wanderer, Gefangenen, Artisten, aber auch
der Soldaten, Reiter und Ritter geworden; die Parallelfigur
Al Khidr wurde Patron der Reisenden und Verzweifelten. Mobilität
und eine unsichere Umwelt spielen in beiden Fällen eine
zentrale Rolle.
|
 |
St.-Georg-Gedenkstätte in Damaskus
|
 |
George W. Bush, 4. April 2002, TV-Sender
Al-Jazeera
|
|
|
Transfer entlastender Vorbilder nach Europa
Gemeinsamkeiten im ostmediterranen Raum entstandener religiöser
Traditionen beschäftigen auch den irakischen Soziologen
Ali Al-Wardi: "Die Heiligen und Fürbitter, von denen
die alten Kulturen eine große Anzahl besaßen",
erfüllten "nicht zu unterschätzende soziologische
und psychologische Funktionen", denn sie "hauchten
auf die Köpfe der Kranken, unterstützten die Unglücklichen,
legten Streitigkeiten bei und geleiteten die Menschen auf
dem Weg ins Jenseits. Anders ausgedrückt, verkörperten
sie für die Menschen den Glauben als etwas de facto Existierendes.
Und wenn jemand in eine schwierige Situation geriet, suchte
er, sie befragend und um ihren Rat bittend, Zuflucht bei ihnen."
Konfessionelle Unterscheidungen trifft er fürs Erste
keine; wichtiger ist ihm die Prägung durch nomadische
und sesshafte Lebensweisen. Während Nomaden im anfangs
relativ einfach strukturierten Islam einen Glauben fanden,
"der sie zu Siegen und Kriegsbeute führt",
hätten Städter, die viel unmittelbarer "unter
der Gewalt des Staates" und unter dem Elend zu leiden
hatten, "das Krankheiten und immer wiederkehrende Epidemien
über sie brachten", eine Religion benötigt,
"die sie in ihren Schwierigkeiten tröstete und ihnen
Zuversicht und Optimismus gab". "Sie
brauchen daher einen Fürbitter, der zwischen ihnen und
Gott vermittelt, denn sie sind in ihrem politischen Leben
daran gewöhnt, dass ein Fürbitter beim mächtigen
Herrscher in ihren Angelegenheiten vermittelt." Die
an heiligen Stätten möglichen suggestiven Situationen
würden das Selbstvertrauen stärken, und das sei,
"wie die moderne Forschung nachgewiesen hat, von großer
Bedeutung für das Heilen von Krankheiten und Lösen
von Problemen". (23)
In entsprechenden Stellen zur Heiligenverehrung im Westen
heißt es: "Weil der Staat als öffentlich-rechtliche
Anstalt nicht existierte, musste man Schutz im Gefolge von
‚Mächtigen' suchen, die dafür Dienste bzw.
Abgaben forderten"; ein wichtiges Motiv sei "die
nutzlose Suche nach Hilfe bei den Ärzten (die des Kontrastes
wegen nicht gut wegkommen)". (24)
Wie sich Al-Khidr und Georg einen Namen machten, der eine
berühmt in seinem Umfeld, der andere fast weltweit, wird
selbst durch die Schilderung sie betreffender Merkwürdigkeiten
nicht klarer. Zu Begriffen wurden sie dennoch. Was nicht zu
benennen ist, darüber lässt sich nicht reden.
Die Namensgebung ist ein erster Schritt dazu. Auf europäische
Traditionen bezogen, ist eines klar: "Erst im Spätmittelalter
kam der Brauch auf, das Kind nach dem Heiligen des Tauftages
zu benennen" und "die Vorschrift, jedem Kind bei
der Taufe den Namen eines Heiligen zu geben", stammt
erst aus Zeiten der beginnenden Aufklärung (25),
die trotz ihrer Polarität zu Religion stark an Mythen
orientiert und "im Kern selbst religiös" gewesen
sei, wie es inzwischen heißt. (26)
Bezüge zur Zeit, auch zu deren Einteilung, sind in mehrfacher
Weise offensichtlich. Der Kalender ist weiterhin von Heiligen
bestimmt, eine dem Islam unbekannte Auffassung; der Tag Georgs
ist der 23. April, Johannes der Täufer bekam die Sommersonnenwende
am 24. Juni zugewiesen, als Gegenpol zur Geburt Jesu am 25.
Dezember, der Wintersonnenwende. "Jeder Tag ein Festtag",
war die Devise.
Viele der dazu herangezogenen Identifikationsfiguren stammen
aus den frühchristlichen Gebieten des "Orients".
Gedacht waren sie eher als Entlastung denn als Vorbilder.
Sie sollten vermitteln und stellvertretend tun, was Normalmenschen
nicht zuzumuten war; Idealtypisches als Verdeutlichung von
Abweichungen. Nach zweitausend Jahren haben
im Katalog (mehr oder minder) anerkannter christlicher Heiliger
und Seliger etwa sechstausend "Gerechte" - so ihre
biblische Bezeichnung - ihren Platz behaupten können.
Für den Islam werden ähnliche Zahlen genannt: In
Sufitraditionen etwa ist von fünfzig Heiligen der höchsten
Hierarchiestufe, von dreihundert "Guten" sowie von
"viertausend verborgenen Heiligen" die Rede. (27)
Der vermutlich volkstümlichste islamische Heilige ist
Abdul Qadir Gilani (1088-1166). Von den christlichen Heiligen
der ersten vier Jahrhunderte bis zur Etablierung der Kirche
stammt mindestens die Hälfte aus dem östlichen Mittelmeerraum;
rund zwanzig Prozent von ihnen sind Frauen. Etwa dreihundert
sind durch weithin verteilte Reliquien auch materiell präsent
geblieben. In keiner anderen Kultur wurden die endgültigen
Ruhestätten von Heiligen so oft verlegt und so weit verbreitet,
zu einem dichten, das frühe Europa konturierenden System
von Gräbern, Fiktionen und Legenden.
In der Namensgebung leben solche Bezüge
auch auf säkularen Ebenen fort. Abgesehen von im Alten
Testament genannten Personen, von Jesus und seinen Angehörigen
und den Aposteln sind - um nur weiterhin gebräuchliche,
von solchen Heiligen übernommene Namen zu nennen - auch
Maria Magdalena, Stephan oder Veronika der Herkunft nach Palästina
zuzuordnen, Simeon war eindeutig aus Syrien, Alexandra, Antonius,
Felix, Katharina, Verena stammen aller Wahrscheinlichkeit
nach aus Ägypten, Antonia, Cornelia, Felicitas, Augustinus
wären im heutigen Sinn aus Tunesien oder Algerien, Barbara,
Christa, Claudia, Dorothea, Helena, Margareta, Georg, Gregor,
Christophorus, Nikolaus, Maximilian, Theodor oder Viktor haben
in der jetzigen Türkei gelebt. (28)
Dass diese "fremdländische" Herkunft wichtiger
Heiliger systematisch verdrängt worden ist, hat die Beliebtheit
der Namen nicht beeinträchtigen können. Auch Kritik
an "nicht bewiesener" Heiligkeit hat sich kaum ausgewirkt.
Sie ist schon für Erasmus von Rotterdam
ein Thema gewesen: "Nehmt einen Heiligen mit einer unterhaltsamen,
poetischen Legende, wie den Georg, den Christophorus, die
Barbara - ihr werdet sehen, dass der viel fleißiger
verehrt wird als Petrus oder Paulus oder selbst Christus";
und natürlich für den keine Vermittler akzeptierenden
Reformator Martin Luther, der zum Beispiel von Barbara als
einer Person sprach, von der "niemand gewiss weiß,
ob sie eine Heilige ist oder nicht". (29)
Andererseits: Den heiligen Nikolaus, der Kindern vor Weihnachten
Geschenke bringt, als Asiaten zu präsentieren, hätte
kultische Ordnungen durcheinander gebracht; auch der Kreuzritter-Patron
Georg oder die bis weit in den Norden von Bergleuten verehrte
Barbara mussten von ihrer regionalen Vergangenheit aus der
heutigen Türkei abgelöst werden. Bei Kaspar, Melchior
und Balthasar, den Heiligen Drei Königen aus dem Morgenland,
hätte das keinen Sinn ergeben; Reliquien von ihnen werden
in Köln und Mailand verwahrt.
Im längst nicht mehr von christlich orientierten Bevölkerungsmehrheiten
geprägten Europa haben auch die Kirchen, im Zuge des
Niedergangs ihrer "gesellschaftlichen Formationskraft",
reagiert, einerseits mit einer neuerlichen Zunahme von Heiligsprechungen,
andererseits durch Distanz zu vielen Kulten, denn "über
die Reliquienverehrung, wie sie im 19. Jahrhundert gleichfalls
neu aufgelebt war, wird heute praktisch nicht mehr gesprochen.
Ja, die allgemeine Ratlosigkeit scheint
bereits in Peinlichkeit umgeschlagen zu sein", heißt
es dazu in einem neuen Standardwerk zum Thema "Heilige
und Reliquien". Dennoch werde weiterhin "in der
Religionsgeschichte der Heilige [und die Heilige, müsste
ergänzt werden] als ‚die eigentlich tragende Erscheinung
der Religion' genannt" und mit dem "Phänomen
des Schamanen", der Funktion "Dazwischentretender"
und ausdrücklicher Weltfremdheit in Zusammenhang gebracht.
(30)
Ob und welche Vermittlerfunktionen höherer
Art akzeptierbar sind, spielt nach den jahrhundertelangen
innerchristlichen Auseinandersetzungen darüber keine
vordergründige Rolle mehr. Verschiebungen ergeben sich
auch deswegen, weil die schaurigen, aus religiöser Erziehung
in Erinnerung bleibenden Geschichten von Verfolgung und Folterqualen
inzwischen als weit übertrieben eingeschätzt werden.
(31)
|
 |
|
Reliquientransfer aus den frühchristlichen
Gebieten nach Europa (teilweise als Kriegsbeute nach
der Eroberung Konstantinopels 1204 im vierten Kreuzzug).
|
|
Frühchristliche aus dem
östlichen
Mittelmeerraum stammende Heilige
mit gebräuchlich gebliebenen Namen
|
Standorte
ihrer Reliquien |
| 1 |
Andreas |
Amalfi,
Patras, Brüssel, Baume / F |
| 2 |
Antonius |
Arles |
| 3 |
Augustinus |
Pavia |
| 4 |
Barbara |
Venedig |
| 5 |
Felix |
Andermatt
/ CH |
| 6 |
Georg |
Reichenau
/ Bodensee, Prag, Köln |
| 7 |
Gregor |
Moskau |
| 8 |
Helena |
Rom,
Paris, Hautvillars / F, Trier |
| 9 |
Hl.
Drei Könige: Kaspar, Melchior, Balthasar |
Köln,
Mailand |
| 10 |
Jakobus |
Santiago
de Compostella |
| 11 |
Johannes
d. Täufer |
Damaskus,
St. Petersburg, Athos, Saint-Jean-d'Angély
/ F |
| 12 |
Lukas |
Padua |
| 13 |
Margareta
/ Marina |
Montefiascone
bei Viterbo |
| 14 |
Maria
Magdalena / Madeleine |
Vézelay
/ F, St-Maxime la-Sainte-Baume / F, Paris, Exeter,
Halberstadt / D |
| 15 |
Maria |
Prato
/ I |
| 16 |
Markus |
Venedig,
Reichenau / Bodensee |
| 17 |
Mathias |
Trier |
| 18 |
Matthäus |
Salerno |
| 19 |
Mauritius |
St.
Maurice / CH |
| 20 |
Paulus |
Rom,
Tarsus, London, Münster, Frankfurt, Korvey,
Malta, Saragossa, Utrecht |
| 21 |
Petrus |
Rom |
| 22 |
Philippus |
Rom |
| 23 |
Simon |
Rom,
Köln. Hersfeld / D |
| 24 |
Stephan |
Rom,
Aachen |
| 25 |
Theodor |
Venedig |
| 26 |
Thomas |
Mailapur
bei Madras, Ortona, Rom |
| 27 |
Verena |
Zurzach
/ CH |
| 28 |
Veronika |
Bordeaux,
Rom |
|
|
| Demonstrative
Radikalität
Gradmesser für die Bedeutung an heiligen
Orten erhoffter Vermittlungserlebnisse ist die "Sakralmobilität",
die als ständiges "Unterwegssein zu einer ‚Gnadenstätte'"
während langer Phasen einen wichtigen Ausgleich zu erzwungener
Ortsgebundenheit geboten hat. Christliche, islamische, hinduistische,
buddhistische Sphären unterscheiden sich dabei kaum voneinander.
Mekka ist weltweit ein sprichwörtliches Symbol dafür
geblieben. In Europa waren Rom, Santiago de Compostella, Canterbury,
Köln und Konstantinopel lange Zeit die vorrangigen Ziele,
später kamen Lourdes oder Fatima hinzu. (32)
Frühe Anziehungspunkte solcher Arten von Pilgernomadismus
waren die - auf Syrien konzentrierten - Säulenheiligen;
gleichsam als Inbegriff von konzentrierter Statik, von Selbsterhöhung.
Eremiten lebten anonym, im Verborgenen, gleichsam als frühe
Protestanten gegen die Attitüden kirchlicher Pracht und
Macht. Ihre Kontrahenten stellten sich und ihre Leistung zur
Schau. Als Verhaltensweise ist daraus fast so etwas wie ein
Muster geworden.
Simeon Stylites der Ältere (um 390-495)
soll mindestens seine letzten dreißig Jahre auf der
für ihn errichteten Säule verbracht haben. Deren
Reste sind noch im Simeonskloster (Qualaat Seman) bei Aleppo
zu sehen, das ihm zu Ehren, als größte kirchliche
Anlage ihrer Zeit, errichtet wurde. Von
seinem exponierten Platz aus überwachte er Gerichtsverfahren,
"machte Prophezeiungen, heilte, ermahnte und beriet die
hohen Funktionäre", heißt es dazu in Mircea
Eliades "Geschichte der religiösen Ideen".
(33) Bis
zuletzt war er "ständig umlagert von einem ‚Menschenmeer'
aus Bewunderern aller Weltgegenden, die die Gegenwart des
Rekordmanns und Wunderheilers wie einen Gottesbeweis in sich
sogen". (34)
Generationen lang ist seinem Extremismus nachgeeifert worden;
Simeon Stylites der Jüngere soll ihn, was die Dauer des
Säulenstehens betrifft, noch deutlich überboten
haben. Ohne Massen von Beobachtern und Nachrichten darüber
hätte all das seinen Zweck verfehlt.
"Auf den Straßen Syriens", heißt es
in "Die Entstehung des christlichen Europa" zu solchen
über indische Fakire bewusst gebliebenen Erscheinungen,
traf man um diese Zeit schon seit langem "charismatische
Prediger, die der ‚Welt' nichts schuldeten. Die
Leute, die in vollkommener Ehelosigkeit lebten, um sich ganz
der Macht des Heiligen Geistes zu ergeben, mussten darauf
hingewiesen werden, dass sie auf dem Weg durch nichtchristliche
Dörfer vielleicht besser keine Psalmen sängen, wenn
sie nicht für ambulante Musiker gehalten werden wollten.
Diese waren die ‚Einzelnen', die ‚Einsamen'. In
Ägypten wurde das griechische Wort dieser Bedeutung,
monachos, bald speziell auf solche Personen angewandt; daher
später unsere ‚Mönche'." (35)
Im Koran finden sich skeptische Aussagen dazu: "Sie
brachten das Mönchtum auf. Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben";
ihre Vorsätze hielten diese Leute "nicht richtig
ein", "viele von ihnen waren Frevler" (Koran
57,27).
Heilig wird auf die Grundbedeutung "stark"
zurückgeführt, der Mönch und die Nonne als
"universaler Archetyp" betrachtet. In der exzessiven
Selbstquälerei sich stolz präsentierender "Hochleistungsasketen"
eine Charakteristik von Verwirrungsphasen zu sehen, greift
zu kurz; offenbar handelt es sich um durchaus wiederholbare
Formen von Egomanie, von Narzissmus. (36)
Mit dem ostentativen Leiden sollte etwas erreicht werden.
Es machte Bewunderer vorübergehend zu Nomaden mit einem
Ziel.
Für eine Statement-Kultur entstanden
Modelle. Zugehörige Dienstleistungen ergaben sich von
selbst. Richard Sennetts Definition des "Star-Systems"
hätte bereits für solche Vorgänge gepasst,
denn es "zieht seine Profite daraus, dass der Abstand
zwischen Berühmtheit und Namenlosigkeit weiter vergrößert
wird, sodass die Menschen schließlich jegliche Lust
verlieren, sich eine Aufführung anzusehen, wenn nicht
irgendeine Berühmtheit auftritt". (37)
|
 |
Luis Bunuel: Simon of the Desert,
Spielfilm, 1965
|
 |
Reste der Simeon-Säule im Simeonskloster
bei Aleppo
|
|
|
Denkmuster: Oasenbewohner und Nomaden
Millionen müssen (manche dürfen) das Schicksal
Kains teilen: "Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde
sein" (Gen. 4,12), als "einer von den Verlorenen"
(Koran 5,30). Demnach wären alle Menschen von Anfang
an Nomaden.
In Bezug auf eine tatsächliche Praxis hat der schon
erwähnte irakische Soziologe Ali Al-Wardi versucht, Denkweisen
arabischer Nomaden auf ihre auch nach einem Sesshaftwerden
noch lange nachwirkende Regelhaftigkeit zurückzuführen;
die sich abzeichnenden Konturen passen auch auf andere: "Der
Beduine will siegen, wo immer er siegen kann", heißt
es da zum Kern dieser Mentalität; und von allen Menschen
"schätzen Beduinen guten Ruf und weitreichendes
Ansehen am höchsten". "Die beduinische Demokratie
beherrscht die Beduinen nur, solange sie in der Wüste
leben." Historische Erfahrungen bestärken
eine Tendenz: "Das Volk betrachtet die Regierung als
seinen Feind, von dem kein Vorteil zu erwarten ist."
"Der Respekt der Beduinen vor dem ‚Mordlustigen',
einem Menschen, der sehr leicht loszuschlagen oder zu töten
bereit ist", sei Folge exzessiv an Ehre und Schande orientierter
Stammesgesetze; deswegen wäre auch ihr Neid "viel
größer und heftiger als bei den Sesshaften".
Sie verachten vieles, unakzeptable Herkunft, die Bauern, die
Städter, Berufstätige generell, zugleich sei klar,
dass sie aus Eigennutz heraus Letztere in der Regel "aber
beschützen und nicht angreifen". (38)
Vor allem das unbedingte Siegenwollen klingt weiterhin sehr
zeitgemäß, wie ein Grundmuster westlicher Wirtschafts-
und Politikdynamik, nach dem üblichen Motto: "Bewundert
wird, wer sich nimmt, was er braucht." Da das allein
nicht so ohne weiteres funktioniert, sind sich von jeglicher
Legitimation lösende Netzwerke, als neuerliche Tribalisierung,
als Clan- und Bandenbildung, als Lobbyismus, überall
wieder ein Thema. Dem Anschein nach entwickeln sich neue Stammesgesellschaften.
Denn "ein Stamm verhält sich so, als sei er die
einzige Versammlung von Wesen, die wirklich als Menschen gelten
können. Die übrigen Stämme sind ‚minderwertig'",
heißt es bei Richard Sennett dazu.
"Allerdings entgeht einem etwas Entscheidendes",
betont er, "wenn man die Dynamik moderner Gemeinschaften
mit Hilfe dieser anthropologischen Kategorie zu begreifen
versucht. Die Zunahme von Intoleranz ist hier nämlich
nicht Resultat von anmaßendem Stolz, Überheblichkeit
oder übertriebenem Gruppenbewusstsein. Sie gründet
vielmehr in einer in sich brüchigen, aus Selbstzweifeln
gespeisten Dynamik, in der die Gemeinschaft einzig aus der
fortgesetzten Zurschaustellung von Gefühlsaufwallungen
ihren Bestand sichert." (39)
"Die nomadische Alternative", wie Bruce Chatwin
sie vergeblich in ein Buch zu fassen suchte, wirkt in einem
solchen Umfeld wie eine Wunschprojektion. Denn
er wollte von Wanderungsmotiven über archaische Jäger
und Sammler und die lange überlegene Mobilität der
Reitervölker bis zum "Heimweh nach dem Paradies",
zu Eskapismen, zur Hirtenvergangenheit der großen Religionen
(aber: "Nomaden sind notorisch irreligiös")
oder zum gegenwärtigen Unterwegssein von Millionen ("zwei
ausschlaggebende Beweggründe": "wirtschaftliche
und neurotische") einen universellen Bogen spannen. Das
Wort "Arab", als Bezeichnung für "Bewohner
von Zelten", war ihm ein wichtiger Ansatzpunkt. (40)
Die Gebundenheit von Nomaden an vorgezeichnete Wege wird in
aller Regel negiert, wenn das Bild von ihnen für andere
Zwecke benutzt wird. Ihre Routen erscheinen dann als Muster
für zeitlose, an Möglichkeiten orientierte Netzwerke,
mit Knotenpunkten und Oasen (bezogen auf Einfluss, Dynamik,
Privilegien, Steuervorteile, Luxus). Ausübung von Macht
ist dabei nicht mehr auf Zentralisierung angewiesen. Solche
neuen, häufig Tätigkeiten und Orte wechselnde Nomaden
sind als "der flexible Mensch" zum problematischen
Inbegriff der "Kultur des neuen Kapitalismus" geworden
(Richard Sennett). Flexibilität meint Verwendbarkeit.
Stammeszugehörigkeit kann nur ererbt
oder erkauft werden; am Horizont auftauchende Fremde werden
genau beobachtet. Das System, in dem sich alle bewegen, "strahlt
Gleichgültigkeit aus", wie jede Wüste. Wer
nicht dazupasst, "wird in die Wüste geschickt";
aus einem mythischen Ort der Gottesnähe wurde eine zynische
Metapher für Verlassenheit. Verbindungen zwischen Arbeit,
Risiko und Belohnung gibt es kaum: "Der Gewinner bekommt
alles." (41)
Die Fähigkeit zu Selbstorganisation wird zur generellen
Anforderung, auch innerhalb der Strukturen. Nationalstaatliche
Grenzen haben sich verflüchtigt, das Geschehen wird von
anderswoher bestimmt. Dass solche Transformationen "von
einem endgültigen Verschwinden des [eigentlichen] Nomadismus"
begleitet werden, da dessen ursprünglichen Formen bald
keine "reale Alternative zu Sesshaftigkeit und Ackerbau"
mehr darstellen können (42),
wie es in diversen Untersuchungen heißt, lässt
den Eindruck entstehen, das Spiel beginne auf anderer Ebene
in gewisser Weise von Neuem.
Damit dürften auch die eingeprägten Bilder verblassen,
die dank der mentalen Transportleistungen religiöser
Überlieferungen nomadischen Einstellungen und Bezügen
zur Wüste Rückhalt geboten haben. Gerade in Europa,
als einzigem Kontinent ohne größere Wüsten,
hatte deren Nachbarschaft nachhaltig romantisierende Wirkungen;
in deutlichem Gegensatz zur Pragmatik ihrer Bewohner. Die
Varianten der vorherrschenden Religion sind von dort importiert;
in die Wüste gehen, hieß lange, sich zu verlieren
oder mit höheren Mächten in intensiven Kontakt zu
treten. Von biblisch motivierten europäischen Auswandererfantasien
wirkt der Eindruck nach, dass "ganz Amerika - und man
ist inzwischen fast geneigt zu sagen: auch der Rest der Welt
- sich bis heute noch auf dem Treck in den weiten Wilden Westen
befindet". (43)
Die Prärie als Ersatz für das Heilige Land. In damit
angesprochenen Vorstellungen des Frühchristentums ist
die bedeutsamste Trennung "nicht diejenige von Stadt
und Land, sondern die der ‚Wüste' von der ‚Welt'"
gewesen, jener Wüste, die als "Ort des ‚engelgleichen'
Lebens der Asketen" gegolten hat, konstatiert Peter Brown
dazu und der Philosoph Peter Sloterdijk bekräftigt: "Man
darf behaupten, dass der Komplex, der als westliche Zivilisation
gilt, auf einer Absage an das Prinzip Wüste beruht."
(44) In verdeckter Weise ist
es präsent geblieben; als Traumgebilde genauso wie als
Endstadium einer denkbaren, vom Menschen gemachten Apokalypse.
Nur vordergründig gilt, dass erst die - mentale und reale
- Vertreibung aus der Umgebung der biblischen Wüste Ansätze
zu einem europäischen Selbstverständnis provoziert
hat, mit der, zuerst gegen Muslime, schließlich gegen
alle möglichen Feinde gerichteten Kreuzzugsidee als abrufbarem
Denkmodell. Denn im Kern war sie auf eine Rückkehr ausgerichtet.
Bemerkbar machen sich solche Vorstellungen immer wieder, trotz
aller gegenteiligen Beteuerungen, wie wichtig es wäre,
dass die Kooperation Europas und der südöstlichen
Nachbarn Perspektiven bekommt, ohne primäre Ausrichtung
auf mobilitätssichernde Tankstellenfunktionen der Ölländer.
Begriffe wie "Abendland" und "Morgenland"
zielten auf eine Trennung ab, so als ob die Sonne nicht täglich
wiederkehren würde.
|
|
 |
|
Wissenschaftlich abgegrenzt: Die traditionelle
Umwelt für Nomaden. In: Fred Scholz: Nomadismus.
Theorie und Wandel einer sozioökologischen Kulturweise.
Stuttgart 1995, S. 33
|
 |
|
Globale Flüchtlingssituation in
der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts. In: Jean-Christophe
Rufin: Das Reich und die Neuen Barbaren. (Paris 1991),
Berlin 1993, S. 82
|
 |
|
Globale Tourismusintensität. In:
Dumont Weltatlas, Köln 1997, S. XXVII
|
 |
|
Globale Migrationsbewegungen 1945-1973.
In: Stephen Castles/Mark J. Miller: The Age of Migration.
International Population Movements in the Modern World.
London 1998, S. 69
|
 |
|
Globale Migrationsbewegungen seit 1973.
In: Stephen Castles/Mark J. Miller: The Age of Migration,
a. a. O., S. 7
|
|
|
|
Landkarten, die ohne die aus Europa gewohnte Betonung von Zersplitterung
auskommen, machen deutlich, welch weite Gebiete der "Alten
Welt" (die um jene des südlichen Afrikas, Amerikas
und Australiens ergänzt werden müssten) traditionellen
mobilen Lebensformen zugeordnet werden. Auf
Mobilität allein bezogen, haben sich die Unterschiede längst
verflüchtigt. Was bleibt, sind Metaphern über nomadische
Vorläufer, als Hinweis auf koloniale und mystische Kategorien
westlicher Sichtweisen: "Die weit gedehnte Wüste,
die grenzenlose gleichförmige Steppe sind erhaben",
heißt es dazu in Rudolf Ottos grundlegendem Buch über
"Das Heilige". (45)
Von Ferne gesehen fallen solche Überhöhungen offenbar
leicht. Geschichte verstellt oft den Blick auf das Jetzt. Längst
hat es die Mehrheit der Menschen in Städte gezogen; verbreitetes
Bild dafür ist es, die ungeordnete Ausdehnung solcher Agglomerationen
mit Wüsten gleichzusetzen. Wer sich künftig um die
Trockengebiete der Erde kümmern wird, ist zum ökologischen
Problem geworden. Auch das Thema "Freizügigkeit"
und "Wanderungen" ist ein globales: "The Age
of Migration" (und des Tourismus) - als ungebrochenes Merkmal
der Moderne, der Gegenwart, ihrer Ängste und Hoffnungen.
Das zeitlose Statement "Wir sind alle Immigranten"
sollte zu Beginn des 20. Jahrhunderts US-Bürger aufrütteln.
(46) Drei
Generationen später sind "Fremde" erneut ein
Angstthema, als krasser Gegensatz zur allgemeinen Mobilität.
Dass die Migrationswellen der letzten zweihundert Jahre ursprünglich
ein "europäisches Produkt" sind, wird verdrängt.
"Sie sind produziert", eine Folge "ihnen Kontur
und Richtung verleihender politisch-ökonomischer Systeme",
heißt es bei Saskia Sassen, einer führenden Analytikerin
globaler Transfers, dazu. (47)
Der absurde Wunsch, sie zum Stillstand zu bringen, negiert,
dass die Unterscheidung von Eigenem und Fremdem längst
zur fragilen, brüchigen Konstruktionen geworden ist.
Vergleiche mit früheren Zeiten helfen wenig. Denn so
wie in der ausgehenden Antike werden anstürmende oder
einsickernde "Barbaren" als Gefahr gesehen und "als
vollkommen Fremde geschildert, die plötzlich aus dem
Nichts erschienen wären", obwohl sie letztlich doch
"als Mitbürger anerkannt werden mussten". (48)
In seinen Analysen solcher Prozesse beruft
sich sogar ein aufgeklärter Gesellschaftstheoretiker
wie Richard Sennett auf Kain und Abel, "weil die moderne,
von Kapitalismus und Säkularismus hervorgebrachte Kultur
notwendigerweise im Brudermord endet, sobald die Menschen
intime Beziehungen zur Grundlage gesellschaftlicher Beziehungen
machen". Da "wirkliche soziale Bindungen als unnatürlich
erscheinen" werde das Geschehen von durch Gefühlserregungen
konditionierten Gruppen geprägt, denen die Außenwelt
"weniger real, weniger authentisch als das Leben innerhalb
der Gemeinschaft" erscheint. (49)
Integrierende Folgen von Vernetzung und Transfers drohen so
neuerlich zum Trugbild zu werden.
Ausgewogene Formen des Austauschs brauchen Rahmenbedingungen.
Die wenig bekannten Umstände einer frühen Ost-West-Erfahrung
machen manches davon deutlich. Denn der erwarteten Ermordung
durch angeblich feindliche Brüder entgangen ist der allseits
als friedfertiger Asket und Ordensgründer geschätzte
Franz von Assisi - Zeitgenosse Ibn Al Arabis, schließlich
sogar Namensgeber von San Francisco. Immerhin schon fast vierzig
Jahre alt, war er im Jahr 1219 nach Ägypten gereist,
um so lange in provokanter Weise zu predigen, bis er als Märtyrer
sterben würde. Wegen der unaufgeregten, durchaus modern
wirkenden Reaktion der dortigen Autoritäten ist ihm dieser
Wunsch nicht erfüllt worden und er musste seine von vorder-
und hintergründigen Interessen geleiteten Vermittlungsmanöver
ergebnislos abbrechen.
In der selben Gegend rund um Kairo, in der Franziskus den
Tod suchte, hat Nagib Machfus seine moderne Fassung des Kain-Abel-Dramas
angesiedelt, als Parabel auf sich wiederholende, durchaus
weltliche Konstellationen (Awlad al-haratina/Children of the
Alley). (50)
Von islamischer Seite scharf verurteilt, ist das Buch dennoch
überall in der arabischen Welt erhältlich. In dieser
behutsam erzählten allegorischen Familien- und Menschheitsgeschichte
geht es um alltägliche Querelen, starre Haltungen, unerwünschte
Verbindungen, Nachfolgefragen, Erbschaftsstreitigkeiten und
scheiternde Vermittlungsversuche. Der Tod von Abel, den er
Humam nennt, ist nach dieser Version ein Unfall, der unglückliche
Ausgang einer von Qadri (Kain) angezettelten Rauferei. Auslöser
der Konflikte sei letztlich der autoritäre Stammvater
der Sippe gewesen, dessen vergleichsweise stattlicher Besitz
ihn als "Herren der Wüste" erscheinen ließ.
Nach und nach kam das Gefühl auf, er würde Anerkennung
und Privilegien höchst unausgewogen verteilen. Gerade
seine aktivsten Angehörigen sind dadurch motiviert worden,
die Regeln der von ihm verkörperten Tradition nicht mehr
so ohne weiteres einzuhalten.
Christian Reder
|
|
 |
zurück |
oben |
 |
|
|
- Koranstellen nach: Der Koran. Übersetzung von Rudi
Paret. Stuttgart 1996; Der Koran. Kommentar und Konkordanz
von Rudi Paret. Stuttgart 2001; Johann-Dietrich Thyen: Bibel
und Koran. Eine Synopse gemeinsamer Überlieferungen.
Köln 2000; F. E. Peters: Judaism, Christianity, and
Islam. The Classical Texts and Their Interpretation. 3 Bände,
Princeton 1990.

- Bibelstellen nach: Die Bibel. Altes und Neues Testament.
Einheitsübersetzung. Freiburg 1980.

- Ali Al-Wardi: Soziologie des Nomadentums. Studie über
die irakische Gesellschaft. (Bagdad 1965), Neuwied 1972,
S. 47; Dora Jane Hamblin: Has the Garden of Eden been located
at last? In: Smithonian Magazine, Washington, Vol. 18, Nr.
2, Mai 1987, http://www.ldolphin.org/eden/

- H. A. R. Gibb (Hg.): The Travels of Ibn Battuta A. D.
1325-1354. New Delhi 1993. Band I, S. 145f; Ibn Gubair in
G. Rotter: Syrien. Nürnberg 1996, S. 145. Zit. nach:
Gebhard Fartacek: Pilgerstätten in der syrischen Peripherie.
Wien 2002.

- Sadik J. Al-Azm: Unbehagen in der Moderne. Aufklärung
im Islam. Frankfurt a. M. 1993, S. 55f., 137, 14.

- Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam. (North
Carolina 1975), Aalen 1979, S. 30.

- Navid Kermani: Gott ist schön. Das ästhetische
Erleben des Koran. München 2000.

- Elaine Pagels: Adam, Eva und die Schlange. Die Theologie
der Sünde. (New York 1988), Reinbek bei Hamburg 1991,
S. 280, 236.

- Mircea Eliade: Geschichte der religiösen Ideen. (Paris
1976), Freiburg 1978. Band I., S. 160.

- Gebhard Fartacek: Pilgerstätten in der syrischen
Peripherie. Eine ethnologische Studie über die kognitive
Konstruktion sakraler Plätze und deren Praxisrelevanz.
Wien 2002, Abschnitt 2.2.2.

- Albert Hourani: Die Geschichte der arabischen Völker.
Von den Anfängen des Islam bis zum Nahostkonflikt unserer
Tage. (London 1991), Frankfurt a. M. 2001, S. 238.

- Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam, a.
a. O., S. 224, 118f.

- Martin Bocian (Hg.): Lexikon der Biblischen Personen.
Stuttgart 1989, S. 104.

- Shaykh Muhammad Hisham Kabbani: The Naqshbandi Sufi Way,
a. a. O., S. 119ff.

- Gebhard Fartacek: Pilgerstätten in der syrischen
Peripherie, a. a. O., Abschnitt 2.6.1/3.2.

- Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien. Die Geschichte
ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart.
München 1994, S. 139f.; Sadik J. Al-Azm: Unbehagen
in der Moderne, a. a. O., S. 13.

- Hans Magnus Enzensberger: Der Agnostiker als Theologe.
Kursbuch "Vorbilder", Heft 146, Berlin 2001, S.
9.

- Sadik J. Al-Azm: Unbehagen in der Moderne, a. a. O., S.
54ff.

- Vera Schauber/Hanns Michael Schindler: Bildlexikon der
Heiligen, Seligen und Namenspatrone. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
München 1999, S. 228ff.; Ökumenisches Heiligenlexikon:
http://www.heiligenlexikon.de;
Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien, a. a. O., S. 118.

- Barbara W. Tuchman: Bible and Sword. England and Palestine
from the Bronze Age to Balfour. New York 1956, S. 149; Edward
Gibbon (1737-1794), englischer Historiker und Schriftsteller.

- Edward Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire.
(1776-1788), New York 1995, Vol. I, S. 692ff.

- Peter Brown: Die Entstehung des christlichen Europa. (Oxford
1995), München 1999, S. 55.

- Ali Al-Wardi: Soziologie des Nomadentums, a. a. O., S.
130ff.

- Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien, a. a. O., S.
194, 141.

- Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien, a. a. O., S.
130, 132.

- Reinhard Kossellek: Aufklärung und die Grenzen ihrer
Toleranz. In: Trutz Rendtorff (Hg.): Glaube und Toleranz.
Gütersloh 1982, S. 269.

- Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam, a.
a. O., S. 222.

- Daten primär aus: Vera Schauber/Hanns Michael Schindler:
Bildlexikon der Heiligen, a. a. O.; Ökumenisches Heiligenlexikon:
http://www.heiligenlexikon.de

- Zit. nach: Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien, a.
a. O., S. 234, 251; Erasmus von Rotterdam (1469-1536), niederländischer
Humanist und Theologe, Martin Luther (1483-1546), deutscher
Reformator.

- Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien, a. a. O., S.
322, 310, 298, 81, 58.

- Peter Brown: Die Entstehung des christlichen Europa, a.
a. O., S. 38; Ferdinand Dexinger/Jos Rosenthal: Als die
Heiden Christen wurden. Zur Geschichte des frühen Christentums.
Limburg 2001.

- Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien, a. a. O., S.
133, 136.

- Mircea Eliade: Geschichte der religiösen Ideen, a.
a. O., Band 2, S. 350.

- Peter Sloterdijk: Weltfremdheit. Frankfurt a. M. 1993,
S. 102.

- Peter Brown: Die Entstehung des christlichen Europa, a.
a. O., S.56f.

- Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien, a. a. O., S.
15, 299, 74.

- Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen
Lebens. Die Tyrannei der Intimität. (New York 1974),
Frankfurt a. M. 1983, S. 363.

- Ali Al-Wardi: Soziologie des Nomadentums, a. a. O., S.
126, 110, 135, 25, 93, 114, 139.

- Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen
Lebens, a. a. O., S. 389.

- Bruce Chatwin: Der Traum des Ruhelosen. (London 1996),
München 1996, S. 99ff., 133, 140.

- Richard Sennett: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen
Kapitalismus. (New York 1998), Berlin 1998, S. 201.

- Fred Scholz: Nomadismus. Theorie und Wandel einer sozioökologischen
Kulturweise. Stuttgart 1995, S. 247f.

- Ulrich Beck: Die Erfindung des Politischen. Frankfurt
a. M. 1993, S. 117.

- Peter Brown: Die Entstehung des christlichen Europa, a.
a. O., S. 142; Peter Sloterdijk: Weltfremdheit. a. a. O.,
S. 104.

- Rudolf Otto: Das Heilige. Über das Irrationale in
der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum
Rationalen. München 1979, S. 89.

- Walter Lippmann: Drift and Mastery. New York 1914, S.
211; zit. nach: Richard Sennett: Der flexible Mensch, a.
a. O., S. 161.

- Saskia Sassen: Guests and Aliens. New York 1999. S. 96,
155f.

- Peter Brown: Die Entstehung des christlichen Europa, a.
a. O., S. 73, 72.

- Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen
Lebens, a. a. O., S. 390ff.

- Naguib Mahfouz: Children of the Alley (Awlad al-haratina.
Kairo 1959). New York 1996

|
|
|
|
zurück |
oben |
 |
|
|
© Christian Reder / Edition Transfer
bei Springer Wien New York 2003
|
|
|
|