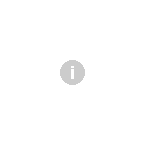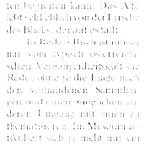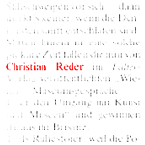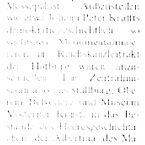|
In Flüchtlingslagern erscheint vieles als sinnlos, vielleicht
in noch stärkerem Maß als bei all dem, was wir sonst noch
"Dritte-Welt-Hilfe" nennen. Das anscheinend Vorübergehende
demaskiert jede Maßnahme als Notlösung. Von allem gibt es
zuwenig, gibt es aber von irgendetwas genug, dann kommt der
Vorwurf der Überversorgung, der Abhängigmachung, der Behinderung
einer Rückkehr und die Gefahr einer aggressivitätssteigernden
Kluft zur lokalen Bevölkerung. Und es muß ja tatsächlich jeder
Eingriff von außen etwas Provisorisches bleiben, weil ja die
Situation des Flüchtlings auch ein Zwischenstadium ist, das
sobald als möglich enden sollte. Inbegriff des Flüchtlings
ist das Zelt, die Hütte, die Baracke. Und irgendwo werden
Instanzen auftauchen, die für das Nötigste sorgen, für etwas
Essen, für Kleider, Decken und eine Verhinderung von Seuchen.
Etwas anderes als die Entwicklung zu Slums oder zu militärisch
kontrollierten Camps scheint kaum möglich. Mit den psychosozialen
Belastungen jeder Flucht, mit der Abwesenheit oder dem Zerfall
gewohnter Strukturen, mit Apathie und Arbeitslosigkeit muß
jeder praktisch selbst fertig werden, wenn nicht doch von
außen neben materiellen Gütern auch eine soziale Unterstützung
angeboten wird.
Zur Erinnerung: Nach der "April-Revolution" von 1978 kam
es in Afghanistan de facto zum Bürgerkrieg, weit sich weite
Teile der Bevölkerung gegen die zunehmende Brutalität der
neuen Regierung wehrten. Deren Maßnahmen waren zwar im Ansatz
vielfach richtig, aber überhaupt nicht oder schlecht vorbereitet,
und keiner der Reformversuche wurde hinreichend akzeptiert.
Im Dezember 1979 intervenierte dann die Sowjetarmee, und der
Krieg wurde zum Volkskrieg gegen die fremde Macht und die
von ihr gestützte Regierung in Kabul.
Bisher sind annähernd drei Millionen Afghanen nach Pakistan
geflohen (etwa 1,5 Millionen sollen in den Iran gegangen sein).
Die Flüchtlinge sind fast zur Gänze arme Bauernfamilien, die
fort mußten, weil ihre Dörfer, die Bewässerungsanlagen oder
ihre Ernten zerstört wurden. Im dichtbesiedelten Pakistan
besteht praktisch keine Chance, daß sie sich durch eigene
landwirtschaftliche Tätigkeit ernähren können. Aus den riesigen
wilden Zeltsiedlungen der ersten Zeit wurden sie inzwischen
in über 300 großen "Flüchtlingsdörfern" mit jeweils einigen
zehntausend Bewohnern zusammengezogen. Für die Basishilfe
(Zelte, Decken, Hygienemaßnahmen, erste Sanitäreinrichtungen
und Gesundheitsmaßnahmen) sorgt primär das UN-Flüchtlingskommissariat
(UNHCR). Eine Reihe anderer Hilfsorganisationen hat kleinere
Aufgaben übernommen. Angesichts der enormen Zahl zu betreuender
Menschen und des sich über 2000 Kilometer erstreckenden Grenzgebietes
stoßen jedoch viele Aktivitäten auf große Schwierigkeiten.
Deshalb sind auch die direkt in den Lagern tätigen Arbeitsgruppen
so wichtig, da sie in unmittelbarem Kontakt mit den Betroffenen
stehen. Allein schon das Bemühen, keine Gelegenheiten für
Korruption zu schaffen, erfordert sorgfältig überlegte Strategien.
Für viele dauert das Flüchtlingsleben schon vier oder fünf
Jahre, und eine politische Änderung der Lage, die eine Rückkehr
erlauben würde, zeichnet sich nicht ab. Allgemein wird angenommen,
daß sich auch in einem überschaubaren Zeitraum keine echte
Chance dazu ergeben wird. Es war daher notwendig, die ursprüngliche
Katastrophenhilfe schrittweise durch entwicklungspolitische
Maßnahmen und Programme zu erweitern, wenn ein nützlicher
Beitrag geleistet werden sollte.
Der Gesundheits- und Sozialdienst des österreichischen Komitees
Das "Österreichische Hilfskomitee für Afghanistan" wurde
Anfang 1980 von verschiedenen Aktivisten, die sich für eine
sinnvolle Hilfe engagieren wollten, gegründet. Als Organisationen
sind in ihm auch die Caritas, die Volkshilfe und Amnesty International
vertreten. Obmann ist Dr. Alfred Janata vom Wiener Völkerkundemuseum,
ein profunder Afghanistankenner. Die Arbeit in Pakistan leitet
der vorher in Wien lebende Afghane Nassim Jawad.
Ich selbst habe als Projektleiter insgesamt vier Monate lang
in Pakistan am Aufbau einer geeigneten Organisation und eines
wirkungsvollen Programms mitgearbeitet und bin jetzt in Wien
für die Fach- und Finanzaufsicht zuständig. Die Geldmittel
stammten zuerst aus privaten Spenden (rund 2 Millionen Schilling),
dann auch aus Mitteln der Bundesregierung und von Hilfsorganisationen.
Inzwischen ist es durch die internationale Anerkennung der
geleisteten Arbeit gelungen, eine internationale Beteiligung
an der Finanzierung aufzubauen, in deren Rahmen wir Regierungs-
oder Spendengelder aus der Bundesrepublik, der Schweiz, aus
England, Norwegen und Dänemark erhalten. Das Gesamtbudget
1980-1983 beträgt 22 Millionen Schilling. Alle in Wien tätigen
Mitarbeiter arbeiten kostenlos. An Büro- und Reisekosten werden
insgesamt nur 7 % des Aufwandes ausgegeben. Die 30 Beschäftigten
in Pakistan sind alle selbst Afghanen, und zwar bis auf zwei
Flüchtlinge. Dies entspricht unserem Konzept, nach dem wir
primär eine von Afghanen selbst verwaltete Arbeitsorganisation
schaffen wollten, um schon dadurch einer "Selbsthilfe" möglichst
nahe zu kommen. Das haben übrigens am Anfang viele Experten
für unrealisierbar gehalten, und deswegen sind auch ziemlich
viele andere teure Experten eingeflogen worden. Von Wien aus
wird für die Finanzierung, die Kontrolle und für Beratereinsätze
gesorgt.
Die Arbeit in Pakistan konzentriert sich auf einen Gesundheits-
und Sozialdienst in den Lagern Baghicha und Gandaf (zwischen
der Stadt Mardan und dem Indus) mit insgesamt 50.000 Bewohnern.
In jedem wurde ein Ambulanzbetrieb eingerichtet. Wie nur bei
ganz wenigen Organisationen stehen dort neben Ärzten auch
afghanische Ärztinnen und weibliches Assistenzpersonal zur
Verfügung. Es ist auch gelungen, die traditionellen Barrieren
abzubauen, die gegen Arztbesuche von Frauen bestanden. Es
werden spezielle Mutter-Kind-, Malaria- und TBC-Programnie
durchgeführt. Es wird laufend versucht, bei den Präventivmaßnahmen
Fortschritte zu erzielen. Die Lagerschulen werden unterstützt,
ein Hygieneunterricht wird abgehalten. Zur Arbeitsbeschaffung
betreiben wir ein Nähprojekt und haben in der Provinzhauptstadt
Peshawar eine Kfz-Lehrwerkstatt eingerichtet, in der derzeit
vierzig afghanische Lehrlinge ausgebildet und Autos repariert
werden. Vieles davon war nur möglich, weil durch die Arbeit
der Ärzteteams inzwischen eine hinreichend gute Vertrauensbasis
besteht. In der oft angespannten Lage ist der Umgang mit Sprechern
verschiedenster Gruppen oder mit ausführlichst diskutierenden
Ratsversammlungen (Djirgas) sonst oft schwierig. Besonders
wichtig ist es natürlich, ein Arbeits- und Ausbildungsangebot
zu schaffen. Erlerntes wird ein Flüchtling auch nach einer
etwaigen Rückkehr brauchen können. Durch viele voll- und teilamtliche
Helfer und Helferinnen im medizinischen Bereich, durch die
Lehrwerkstatt, durch Seminare und die Mitwirkung an den Schulen
sind durch unsere Teams schon einigen hundert Flüchtlingen
brauchbare Kenntnisse und Erfahrungen vermittelt worden. Etwa
einmal jährlich wird das Programm von einem für zwei Monate
aus Wien entsandten Arzt in Form einer beratenden Mitarbeit
weiterentwickelt. Einmal ist es sinnvoll erschienen, durch
eine für sechs Monate eingesetzte Frauenbetreuerin die auf
diesem Gebiet begonnenen Maßnahmen zu forcieren. Und jetzt
ist im Rahmen solcher Überlegungen die Entsendung von zwei
Architekturstudenten aus Graz geplant, nach deren Plänen und
Vorüberlegungen im Lager Baghicha ein einfaches Gebäude für
die Ambulanz errichtet werden soll.
Ambulanzgebände im Lager Baghicha
Die derzeitige Ambulanz des Lagers Baghicha ist auf einem
zirka 20 mal 40 Meter großen, von einer Lehmmauer umgebenen
Areal in mehreren Zeiten untergebracht. Hitze, Kälte, Regengüsse
und Wind erschweren daher die Arbeit. Im Lager selbst, in
dem 30.000 Menschen leben, hat sich der Prozeß von der Zeltsiedlung
über erste Umgrenzungsmauern hin zum eigenhändigen Bau von
Lehmhäusern längst vollzogen. Es wurde zunehmend dringlicher,
auch für die Ambulanz ein festes Gebäude zu bauen. Die naheliegende
Möglichkeit, mit örtlichen Arbeitskräften "irgendwie" etwas
hinzubauen, haben wir in diesem Fall verworfen, weil durch
die Fülle an Arbeit für die Projektleitung (sie führt z. B.
auch Sanitärprogramme der UNO in anderen Gegenden durch) eine
überlegte Vorplanung und Bauaufsicht nicht gewährleistet war.
Außerdem liegt das Areal der Ambulanz zentral an der Hauptstraße,
direkt neben der inzwischen errichteten kleinen Moschee und
dem Bazar, und wir wollten deswegen auch über eine sinnvolle
"Architektur" nachdenken und zugleich eine wirklich zweckmäßige
Lösung mit einer gewissen Signalwirkung finden. Die Ambulanz
ist eines der wichtigen sozialen Zentren des Lagers und nach
bereits jahrelangem Flüchtlingsdasein hatte das Argument für
ewige Provisorien an Gewicht verloren. Die Auffassung, daß
es nur nötig sei, an afghanische Handwerker Aufträge zu vergeben
und die dann schon wüßten, mit welchem Grundriß, in welcher
Bauweise und mit welcher Ausstattung so ein Haus am besten
zu errichten sei, stimmt nur zum Teil. An den bisher in Eigenregie
errichteten Hütten und Häusern war die Tendenz zur Slumbildung
erkennbar, die zweifellos als Element eines psychosozialen
Kreislaufes gesehen werden muß. Aus einer permanenten Vernachlässigung
gewohnter Lebensweisen und Qualitäten würde zunehmend auch
eine psychische Verelendung resultieren. Daheim sind überwiegend
großzügig angelegte Streusiedlungen üblich, die Enge des Lagers
ist etwas völlig Neues. Im feucht-heißen Klima Pakistans stimmt
aber offenbar auch die mitgebrachte Bauweise nicht mehr. Im
Monsunregen halten die Lehmmauern nicht lange, Holz ist teuer.
Es wird kaum versucht, simple Lüftungssysteme zu installieren.
Andererseits hatten wir die Vorstellung, daß eine Bauausführung
durch pakistanische Betriebe, die oft gebrannte (und teure)
Ziegel oder auch Beton verwenden, zuwenige Impulse für die
Bauweise im übrigen Lager liefern würde und außerdem keine
Arbeitsplätze für Flüchtlinge schaffe. Im weiteren sprach
für eine Beratung, daß ein Durchdenken des Funktionsschemas
einer solchen Ambulanz, in die sich oft Hunderte Menschen
drängen, in der eine gewisse Trennung von Männern und Frauen
stattfinden muß, in der untersucht und behandelt wird, in
der Patientenkarteien geführt, Medikamente ausgegeben und
ein Labor betrieben wird, die Arbeitsweise in einem neuen
Bau verbessern könnte. Derartige Erfahrungen fehlen im Lager,
weil weder Ärzte noch Handwerker je mit solchen Problemen
konfrontiert waren. Außerdem zeichnete sich ab, daß irgendwann
die Fertigteilbarackenindustrie kommen würde (mit importierten
"Low-Cost-Housing" Typen), und wir haben die Hoffnung, durch
einen vorbildlichen einfachen Bau in adaptierter lokaler und
afghanischer Tradition solchen Tendenzen entgegenwirken zu
können und einer "Selbsthilfe" Mut zu machen.
Die Projektstudien
Es ergab sich der Kontakt mit Günther Domenig, und er stimmte
spontan einer Zusammenarbeit zu und auch der Auffassung, daß
eine derartige Aufgabe für die Architekturstudenten seines
Institutes eine interessante Bereicherung sein könnte. Uns
selbst hat die ihm vorauseilende Legende angespornt, nach
der er mit nicht fix vorgeplantem Bauen und einer kooperativen
Zusammenarbeit von Planern und Handwerkern experimentiere.
In Gesprächen mit Vertretern universitärer Bereiche war mir
immer wieder aufgefallen, daß durchaus ein Interesse an praktischen
Aufgabenstellungen besteht, jedoch im Rahmen der jetzigen
Organisationsformen nur punktuell kreative "Arbeitsgemeinschaften"
mit externen Auftraggebern eingegangen werden. Gerade für
uneigennützige Unterstützungsprogramme müßte an den Hochschulen
ein organisierbares Potential aktivierbar sein. Zumindest
aber wäre es interessant, die Intensität landläufig behaupteten
Engagements auszuloten und die Bereitschaft, sich sozusagen
außertourlich mit der sozialen Situation anderer zu befassen.
Der Zugriff zu gedrucktem Wissen ist in extensiver Form möglich,
verschiedene Stellen müßten einfacher als von privater Seite
um Informationen oder Mitarbeit angegangen werden können.
Durch eine Ausdehnung der Aufgabenstellungen, in Seminararbeiten,
Dissertationen oder in Projektgruppen müßten sich akute Fragen
auch in praktisch nutzbarer Weise fundiert aufarbeiten lassen,
gerade in bezug auf eine bessere Kooperation des reichen "Nordens"
mit dem armen "Süden".
Das war in etwa der Denkhintergrund; bei dem konkreten kleinen
Projekt gingen wir jedoch davon aus, daß selbst dann, wenn
die erarbeiteten Vorschläge nicht eine befriedigende Realisierungsreife
erlangen würden, sich ein Versuch lohne. Die monatelange Befassung
einer Reihe von Studenten mit der Lagerproblematik würde diesen
selbst, dem Institut und über das Komitee auch der Weiterarbeit
in den Lagern in jedem Fall Anregungen bringen und keine Spendengelder
verbrauchen. Eines ist nämlich grotesk, wie unzugänglich gerade
wichtige, unmittelbar in der Praxis helfende Informationen
gehalten werden, z. B. in bezug auf so ein Hilfsprogramm.
Das Gute daran ist nur, daß es wenigstens kaum halbwegs überzeugende
"Handbücher" gibt, die anordnen, wie das oder jenes auf standardisierte
Weise zu machen ist.
Die ersten konkreten Kontakte mit Günther Domenig gab es
im Sommer 1982. Im darauffolgenden Herbst änderten sich nochmals
unsere Anforderungen. Anfangs war uns ein Mehrzweckgebäude
im Lager Gandaf, das hauptsächlich als Frauenhaus dienen sollte,
wichtiger erschienen. Nach der Auflehnung vieler Männer gegen
ein in Betrieb befindliches Provisorium schien uns eine weniger
spektakuläre Fortsetzung vernünftiger, und der Bau eines einfachen
Ambulanzgebäudes im Lager Baghicha erhielt die erste Priorität.
Anfang 1983 wurde in Graz konkret mit den Planungsarbeiten
begonnen. Auf einer Art Hearing haben wir mit Dias die Situation
in den Lagern und die Bauformen in Afghanistan vorgestellt
und die Probleme der Infrastruktur und der Verhaltensweisen
im Lager diskutiert. Über 30 Studenten waren anwesend und
haben ihr Interesse an einer Mitarbeit angemeldet. Am Institut
wurde ein umfangreicher Fragenkatalog ausgearbeitet, der die
Grundlage für konkrete Fragen an uns und verschiedene Experten
bildete. Im Februar, im Mai und Anfang September fanden nochmals
Treffen statt. Schließlich haben drei Studenten konkrete Projektstudien
abgeliefert.
Sie werden derzeit nochmals überarbeitet und sollen in der
Endfassung Anfang Oktober vorliegen. Bis dahin muß auch entschieden
sein, welcher Vorschlag schließlich als primäre Grundlage
für die Bauausführung dienen soll und wer in Pakistan als
bezahlter Entwicklungshelfer die Bauleitung übernimmt. Gebaut
soll von Mitte Oktober bis Ende November dieses Jahres werden,
erfahrungsgemäß reichen sechs Wochen für das vorgesehene Volumen
aus. Als Baukosten haben wir 150.000 Schilling budgetiert,
was angesichts der lokalen Preise realistisch sein dürfte.
Die Tageslöhne für Hilfsarbeiter liegen bei 40 Schilling,
für Facharbeiter, Maurer oder Tischler bei 120 Schilling.
Eine Fuhre Lehm kostet etwa 100 Schilling, hundert Ziegel
kosten 60 Schilling, ein Sack Zement 100 Schilling.
Bei den drei konzipierten Projekten sind für uns besonders
die (hier nicht abgebildeten) Grundrißlösungen wichtig, die
auf verschiedene Weise Abgrenzungen zwischen Männer-, Frauen-
und Personalbereich vorsehen und teilweise überdachte Innenhöfe.
Sie gehen von Ablaufschemata aus, die wirklich Verbesserungen
erwarten lassen (z. B. durch beidseitig, einmal für Männer,
einmal für Frauen zugängliche Räume, wie Behandlungszimmer,
Apotheke oder Labor). Bei Sonnenschutz und Durchlüftung gibt
es überlegte Lösungen. Als Material sind Lehmziegel oder Stampflehm
vorgesehen (vor ein paar Jahren wäre sicher auch ein Entwurf
für ein geschäumtes Polyesterhaus mit dabei gewesen).
Das Projekt von Johannes Melbinger basiert auf aus Ziegel
zu errichtenden Kuppelelementen. Er bezieht sich ausdrücklich
auf die einschlägigen Vorarbeiten des auch hierzulande berühmt
gewordenen ägyptischen Architekten Hassan Fathy und dessen
Modelle für ein kooperatives, qualitätvolles Bauen, für eine
organisierte Nachbarschaftshilfe und Handwerkerausbildung.
Gerhard Salzer entwarf einen Stampflehmbau mit begehbarem
Dach, auf dem sich der Wassertank befindet. Durchbrochene
Ziegelwände sorgen für die Durchlüftung, die Toiletten sind
außen angebaut und von dort zu entsorgen.
Heinz Spuller lieferte eine dem verwandte Konzeption und
kann durch Hinzunahme eines jetzt noch außerhalb liegenden,
in die rechteckige Grundfläche einspringenden Grundstücks
einen Funktionsablauf entlang einer zentralen Raumabfolge
erreichen.
Für eine praktische Mitarbeit hat sich noch der Bildhauer
und Ethnologiestudent Wolf Gössler, der Erfahrungen im Lehmbau
hat, interessiert. Für alle Teilnehmer besteht die Möglichkeit,
kurzfristig an einem Lehmbaukurs in Bayern teilzunehmen. Es
war von Anfang an darauf verzichtet worden, einen "Wettbewerb"
abzuhalten. Die Endauswahl soll sich aus der internen Diskussion
der vorliegenden Projekte, ihrer Grundlagen und der persönlichen
Erfahrungen ergeben. Für die Bauaufsicht in Pakistan sind
ein oder zwei der Projektbearbeiter vorgesehen. Die bisherigen
Arbeiten hatten bewußt einen Studiencharakter. Der konkrete
Bau soll dann in Kooperation mit dem lokalen medizinischen
Personal und den Handwerkern realisiert werden. Nach Möglichkeit
sollen darüber hinaus auch die am Institut von Assistent Peter
Hellweger - der das gesamte Programm betreut hat - erarbeiteten
Unterlagen zur Infrastruktur des Lagers nutzbar gemacht werden.
Es liegen Schemazeichnungen und Beschreibungen von einfachen
Wasserfilteranlagen vor, von verschiedenen Systemen zur Fäkalienentsorgung
und zur Naturdüngeraufbereitung und Antworten auf eine Reihe
von Einzelfragen, die sich während der Vorbereitungsphase
gestellt haben. Von solchen über den eigentlichen Bau hinausgehenden
Hinweisen und Modellen erhoffen wir uns eine wichtige Unterstützung
bei Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen
im Lager, die angesichts seines Umfanges sicher noch nicht
einen "akzeptablen" Standard erreicht haben. Überdies tritt
auch hier wieder die Ausbildungsmöglichkeit als wichtiges
Kriterium hinzu.
Eine Erfahrungsauswertung
Damit eine solche Falldarstellung nicht leblos im Raum stehen
bleibt, möchte ich noch einige Bemerkungen zum Hintergründigen
dazustellen. Bei Vorhaben dieser Art besteht - einmal wertfrei
gesagt - eine gewisse Polarisierung zwischen der "Professionalität"
routinierter Organisationen und engagierter "Spontaneität"
von Individuen oder Komitees. Vertreter des einen Flügels
beäugen oft mißtrauisch die des anderen. Einmal heißt der
Vorwurf "Naivität" (sollte sie in Zynismus umkippen?), das
andere Mal "Emotionslosigkeit" (oder sogar materielle oder
geistige Korruption). Bei einer (privaten) Initiative ist
schnell die Mutmaßung da, über das, was mit ihr eigentlich
wirklich gewollt wird, und darüber, wer dahinter stecken mag.
Das Unbehagen über unzulängliche oder gänzlich falsche "Hilfe"
oder "Kooperation" mündet oft in einen Wettstreit, wer nun
den radikaleren Standpunkt einnimmt (wer nun linker ist) und
daher letzten Endes wirkungsvoller. Die wichtige Unterstützung
für Befreiungsbewegungen entartet bisweilen zur Mode, dort,
wo es um sozial kompliziertes Alltagsleid geht, zieht es weniger
Leute hin. Wird die geleistete Arbeit halbwegs normal bezahlt,
kommt das Gefühl (und oft schon wieder der Vorwurf), jemandem
etwas wegzunehmen. Wird sie umsonst geleistet, erhält sie
Verbindungen zu Hobbies oder andersartigen Interessen. Es
kommt auch bisweilen der peinliche Nebeneffekt zum Tragen,
daß eine Mitwirkung an Hilfsprojekten zwangsläufig (durch
persönliche Spendenaufrufe oder Medienberichte) bzw. sogar
auf eine kalkulierte Weise zu einer öffentlichen Profilierung
verhilft, die sich dann auch anders benutzen läßt. Wer viel
tut, rückt vielleicht sogar irgendwelchen Mittelpunkten näher,
wer zurückhaltend bleibt, tut zuwenig für "seine" Sache. Aber
alle wollen sie, diese gewisse Art von Personifizierung.
Erika Pluhar reist eigens mit einer Fotographin zur Polisario
in die Sahara, und die dazu passende Illustrierte gibt es
auch schon. Manche jetten um den Erdball von Krisenherd zu
Krisenherd, um sich dann über den "Krisentourismus" und anderes
zu alterieren (wie das Benard/Schlaffer-Duo). Und es gibt
"natürlich" genug Leute, die aus Hilfsprojekten eine Profession
und ein Geschäft machen. Aus der Sicht unkonventionell und
ohne großen Aufwand arbeitender Komitees wird ziemlich schnell
erkennbar, wer sich eventuell gestört fühlt (und sich die
billige Konkurrenz vom Leib halten will). Aber so ist es eben,
könnte man/frau sagen.
Ernsthafte Kritik an der Realität konkreter Projekte ist
schwer öffentlich zu vermitteln, weil ihnen die allgemeine
Stimmung sowieso bestenfalls kurzfristig geneigt ist. Und
der Verdacht eines generellen Nicht-Funktionierens und (zumindest)
lokaler Mißwirtschaft kann durch sie allzuleicht geschürt
werden. Ein lautes Wort, und es droht Schaden. Dabei suchen
die potenteren Hilfsorganisationen praktisch alle personell
gut ausgestattete und vernünftig arbeitende Projektgruppen
(die vielzitierte "implementing capacity"), damit Gelder sinnvoll
eingesetzt werden können. Daß es von ihnen zuwenig gibt, ist
- pragmatisch gesagt - eines der Hauptprobleme. Wer soll denn
sonst Erfahrungen und Sensibilität ansammeln können für die
dringenden größeren Aufgaben?
Das führt zu einer weiteren Erfahrung, nach der fast nur
mehr etwas funktioniert, wenn es informell funktioniert. Z.
B. einen Arzt für einen kurzfristigen Einsatz aus einem Wiener
Spital frei zu bekommen, erfordert immer Sonderaktivitäten.
Das normale Ansuchen bringt gar nichts (trotz Ärzteschwemme?).
Bruno Kreisky und sein (engeres) Team standen z. B. offensichtlich
hinter den lapidaren Intentionen des Afghanistankomitees,
und er hat sich immer wieder berichten lassen. Zuerst gab
es Geld aus dem Katastrophen-, dann aus dem Solidaritätsfonds,
zuletzt von der Entwicklungshilfe. Jetzt ist dieses direkte
Interesse plötzlich weg, und die Informationskanäle suchen
sich neue Wege. Es fehlen unvermutet die damaligen Weisungen,
und auf Beamtenebene beginnt für das Komitee im vierten Jahr
seiner Tätigkeit die Kommunikation sozusagen wieder in der
Stunde Null, mit bereits lange vorher an anderer Stelle deponierten
Erklärungen, Zahlen und Argumenten. Und bei den höheren Instanzen
fängt erneut ein Werben um Interesse und allfällige Interventionen
an. Spendengelder aus Österreich gibt es ja kaum mehr für
diesen entlegenen Krisenherd. Daß es einmal gelungen ist,
beträchtliche internationale Mittel für eine österreichische
Initiative zu gewinnen, führt zum Argument, daß ja dann kaum
noch Steuergelder nötig seien. Das bisherige - offenbar motivierende
- Finanzierungsmodell, nach dem von Österreich aus primär
die Kosten für die Projektleitung in Peshawar (15 % des Gesamtaufwandes)
gedeckt werden, um dadurch Auslandsorganisationen den Anreiz
zu bieten, daß ihre Mittel direkt und ohne Verwaltungskostenabzug
für das Hilfsprogramm eingesetzt werden, wird nunmehr unter
Hinweis auf das Entwicklungshilfegesetz für nicht mehr vertretbar
gehalten. Daß wir teilweise kostenlos im Auftrag der UNO Hilfsmaßnahmen
durchführen (nicht aber, daß wir von ihr beträchtliche Medikamentenlieferungen
umsonst bekommen), stößt auf Kritik, genauso wie diese oder
jene Einzelposition. Dabei war es nicht unser Anliegen, einmal
bewilligte Mittel stereotyp prolongiert zu bekommen, sondern
ein vertretbares Minimum an Integration in die staatliche
Entwicklungshilfe zu erreichen. Aber so ist es eben, und wir
werden so gut es geht mit Auslandsmitteln weitertun. Das Bauprojekt
"Ambulanz in Baghicha" ist bei den jetzigen Gesprächen auf
kein erkennbares Interesse gestoßen und auch nicht der Aspekt,
solche Fragestellungen verstärkt in hiesige Hochschulen hineinzutragen
oder sie dafür etwas mehr zu öffnen. Es wird mit Auslandsgeldern
gebaut werden müssen. Sicher waren es "Kommunikationsmängel",
die an der sich abzeichnenden österreichinternen Wendung mitwirken,
aber die personellen Kapazitäten für ein Neubeginnen sind
in einem kleinen, nebenamtlich geleiteten Komitee eben begrenzt.
Zum Thema Initiative: Seitens des Institutes für Gebäudelehre
an der TU Graz ist z. B. Prof. Gernot Minke. der unter anderem
auf Lehmbauten spezialisiert ist, von der Gesamthochschule
Kassel (Forschungslabor für experimentelles Bauen) um Rat
angesprochen worden, und es haben sich einige für die Lagersituation
wichtige Erkenntnisse aus diesem Kontakt ergeben (u. a. daß
durch andere Mischungsverhältnisse und einen höheren Kiesanteil
Lehmmauern dem für Afghanen ungewohnten Monsunregen besser
widerstehen). Ein ähnlicher Kontakt mit einem in die hiesige
Entwicklungshilfe integrierten Hygieneprofessor aus Graz brachte
die Vorführung von Dias mit gemauerten, wellblechgedeckten
Baracken und AbortanIagen im Sudan, die baulich in keiner
Weise ein Optimum darstellten, penible Erkundigungen über
das Komitee in Wien, seinen gerüchteweise kolportierten Vorwurf
"studentischer Naivität" und sonst nichts weiter.
Von den damit auch angesprochenen Studenten blieben von den
anfangs über dreißig schließlich nur drei. Diese Ausfallsrate
wird mit abflauender Anfangsbegeisterung und dem Ziel, das
Studium möglichst rasch zu beenden, erklärt. Die Möglichkeit,
den ersten "eigenen" Bau zu errichten und in einer fremden
Umgebung durch (sogar halbwegs gut bezahte) Arbeit Erfahrungen
zu gewinnen, wirkte offenbar nicht allzu motivierend. Aber
dahinter steckt noch einiges anderes, wie z. B. die von den
Studenten deutlich angesprochene Unzugänglichkeit vorhandener
Informationen: "Kaum jemand gibt irgendetwas vernünftiges
her für so ein Vorhaben. Sie lassen einfach nichts aus, obwohl
das doch alles schon oft gemacht wurde, und es sicher irgendwo
dokumentiert ist, wie man dort fundamentiert, Lehmziegel macht,
die Arbeit strukturiert." Und daß keine wirklich exakten Angaben
da waren, "das war uns schon einmal unheimlich, und wir hatten
alle das Gefühl, das geht ins Uferlose".
|
|